... link (0 Kommentare) ... comment
Und als kürzlich dieser serbische Kriegsverbrecher, der in Den Haag angeklagt ist, Selbstmord beging: "Das ist praktisch, da verkürzt er das Verfahren. Do it yourself!"
... link (11 Kommentare) ... comment
... link (0 Kommentare) ... comment
... link (0 Kommentare) ... comment
... link (0 Kommentare) ... comment
... link (0 Kommentare) ... comment
... link (6 Kommentare) ... comment
http://www.bootsektorblog.de/2006/02/yahoo_verbannt_.html
... link (3 Kommentare) ... comment
Da sehen wir, wohin uns das Konzept der multikulturellen Gesellschaft gebracht hat, das von uns sozialrevolutionäen Autonomen immer bekämpft worden ist. Für uns war die Multikultur der Multirassismus, eine Nebeneinander voneinander abgeschotteter Kulturen nicht das, was wir wollten. Als wir auf die Hetze von der "Asylantenflut" die "Kampagne für freies Fluten" organisierten, schwebte uns schöpferische Zerstörung vor: Die Aufweichung und Veränderung der deutschen Kultur durch fremde Einflüsse und die Veränderung der Kultur der Einwandernden durch Vermischung mit der deutschen Kultur, eine Transformation der bestehenden Kultur durch Synthese, kurz: Der Schmelztiegel. Was wir heute vorfinden und was selbst im Geist der Kritischen Theorie aufgewachsene Linke wie Georg Seeßlen OK finden, ist nichts weiter als der "Ethnopluralismus" der Neuen Rechten.
Ich scheiße auf jede ethnische Identität, Kampf der Tyrannei des Nationalen!
Und statt Religionsfreiheit wäre mir die Freiheit von der Religion lieber.
... link (9 Kommentare) ... comment
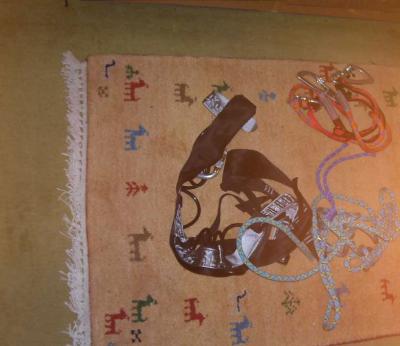

Dabei ist festzustellen, dass ich die schwerwiegendste Wirkung, die ich jemals erreichte, mit einem simplen Fax bewerkstelligte. Es gelten halt immer noch die Worte Abd el Kaders: "Zwei Dinge beherrschen die Welt, das Schwert und die Feder, doch die Feder ist mächtiger."
Und vielleicht hat ausgerechnet der alte Freischärler die Zivilgesellschaft vorausgesehen. Wer weiß!
... link (0 Kommentare) ... comment

... link (3 Kommentare) ... comment
 , aber mit den Jahren habe ich den Komfort der Deutschen Bahn schätzen gelernt, zumal das Wetter sehr zu wünschen übrig ließ. Es war ein wunderschönes, dekadentes, extrem genussvolles Wochenende, und abseits der gelebten Dekadenz, die man genießt und schweigt, stellte sich heraus, dass auch Göttinger Antikmöbelläden Dinge zu bieten haben, die sich nicht hinter einem Herrn Miri zu verstecken brauchen:
, aber mit den Jahren habe ich den Komfort der Deutschen Bahn schätzen gelernt, zumal das Wetter sehr zu wünschen übrig ließ. Es war ein wunderschönes, dekadentes, extrem genussvolles Wochenende, und abseits der gelebten Dekadenz, die man genießt und schweigt, stellte sich heraus, dass auch Göttinger Antikmöbelläden Dinge zu bieten haben, die sich nicht hinter einem Herrn Miri zu verstecken brauchen:

 .
.Das darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt arm ist und sukzessive verslumt. Nachdem einíge gute und renommierte Lehrstühle von der niedersächsischen Landesregierung aus ideologischen und klientelistischen Gründen dicht gemacht werden, ist die Destruktion einer der traditionsreichsten deutschen Universitäten bereits eingeleitet. "Aufstieg durch Bildung", das war das seinerzeit ausgerechnet vom Gewerkschaftsflügel der
SPD und dem gelben Koalitionspartner in trauter Zweisamkeit betriebene Konzept der 70er Jahre, das die elitäre und verknöcherte Ordinarienuiversität in die moderne Massenuniversität umwandelte und mit Gesamtschulen und Orientierungsstufen neue Wege auch in der schulischen Bildung beschritt. Ach ja, das war auch erst die Zeit, als koedukativer Unterreicht begann und die Lehrer aufhörten, Schüler zu schlagen.
Nun, offensichtlich soll das Ganze umgedreht werden: Universitäten sollen verschlankt, in Profit Center verwandelt und verkleinert werden. Wer braucht schon Politikwissenschaftler oder Interkulturalismusexperten? Die sind nicht verwertbar und produzieren am Ende noch kritisches Bewusstsein. Bewusstsein ist ja überhaupt so eines von diesen komischen linken Schlagwörtern.
Hieß also das Konzept damals Aufstieg durch Bildung, so kann man wohl annehmen, dass "Abstieg durch weniger Bildung" oder "Zurück zur geschichteten Gesellschaft" das Konzept aktueller, besonders aber Wulff´scher Bildungspolitik ist. Dass auf diese Stadt noch ganz andere Probleme warten, wird unmittelbar neben dem Campus deutlich, übrigens unweit von der Stelle, wo seinerzeit Conny getötet wurde.
http://netbitch1.twoday.net/stories/1575267
Hier blühte auch in Göttingen die New Economy, hier ist sogar eine international tätige PR-Agentur ansässig, die als AG firmiert.

Schauen wir aber näher hin, so fällt mal wieder auf, dass unheimlich viele Büroflächen günstig zu haben sind, und da die Geschehnisse um die Göttinger Gruppe nichts Gutes vermuten lassen
http://www.ra-hahn-mcl.de/goettingergruppe.htm#endgueltig
so ist zu erwarten, dass der Crash erst noch kommt. Etwas Tröstliches gibt es ja: Von diesem Bürogebäude sind es zum Gericht keine 100 Meter :-)

Anyway, für mich war es ein perfektes Wochenende.
... link (2 Kommentare) ... comment
http://www.youtube.com/watch.php?v=PsrGguzpvSc
... link (1 Kommentar) ... comment
Ich habe ja gerade gelesen, dass unser Sonnensystem aus mehr als 9 Planeten besteht. Eigentlich hätte das schon lange klar sein müssen: 1930 entdeckte Clyde Tombaugh den Winzling Pluto aufgrund von Bahnstörungen des Risenplaneten Neptun. Im Grunde war man sich von Anfang an bewusst, dass ein solcher Midget die Bahnstörungen nicht verursacht haben konnte. In den 70ern berechneten dann Astronomen einen hypothetischen Riesenplaneten Transpluto, der aber nie gefunden wurde. Nun hat man einen Planeten jenseits des Pluto lokalisiert, der wiederum sehr klein ist, weswegen noch weitere Objekte zu vermuten sind. Das allein ist eine astronomische Sensation; doch wie tauft man ihn? Sedna. Ein nichtssagender Name. Bei einem Planeten jenseits des Pluto hätte ich einen Namen wie Hades oder Tartaros, Micky oder Goofy, Rupert oder Zaphod erwartet. Das nächste Mal gebt Euch mehr Mühe!
... link (4 Kommentare) ... comment
... link (7 Kommentare) ... comment
Das Schlimme ist: Wir brauchen gar kein Wahrheitsministerium mehr, das den Leuten die Propagandalügen auftischt, den Job erledigt längst die ach so freie Presse.
... link (3 Kommentare) ... comment
http://www.sosf.ch/blog/2005/06/wir-sind-die-schweiz-mehr-als-8000.html
... link (0 Kommentare) ... comment
Eines Tages - und ich glaube, es wird nicht mehr sehr lange dauern - wird am Himmel ein gigantischer Arsch erscheinen und diese Welt fürchterlich zusammenscheißen.
... link (3 Kommentare) ... comment
Warnung: aus meiner Sicht guter Text, aber ohne Marx-Kenntnis und Grundbegriffe der Wirtschaftshistorie wohl nicht lesbar.
Die Wertkritik erfreut sich in linken Zusammenhängen ungebrochen großer Beliebtheit. Auch nach dem kürzlichen Ausschluß seiner prominentesten Figur Robert Kurz aus dem Krisisprojekt steht eher eine Erweiterung bzw. Verdopplung der Bedeutung dieser marxistischen Denkrichtung zu erwarten, da der Ausschluß von Robert Kurz, Roswitha Scholz u.a., so wird aus Insider-Kreisen berichtet, primär mit internen persönlichen Querelen denn mit inhaltlichen Differenzen innerhalb der Krisis-Gruppe zu tun hat. Anlaß genug sich einmal mit den grundsätzlichen Merkmalen und Basiskategorien dieses Diskurses kritisch auseinanderzusetzen.
Der vorliegende Aufsatz versucht aufzuzeigen, in erster Linie in der Auseinandersetzung mit grundlegenden Arbeiten der Krisis-Gruppe Nürnberg, welche im Jahre 1986 als Herausgeber der Zeitschrift »Marxistische Kritik« ihre Arbeit begannen aber auch mit denen des ISF (Initiative Sozialistisches Forum) Freiburg und anderer, daß zentrale theoretische Inhalte der spezifischen Marxinterpretation dieser sogenannten Wertkritik keine Praxisimplikation besitzen - mehr noch den Prozeß emanzipativer Praxis in Hinblick auf das Widerspruchsverhältnis Kapital Arbeit theoretisch blockieren.
Die Marxsche Kategorie des Werts, wie sie anknüpfend an Ricardo formuliert wurde, muß im Marxschen Sinne als Kategorie verstanden werden, die sich nicht anschicken will mit dem Begriff des Werts eine überhistorische Kategorie zu postulieren. Der Wert, im kapitalistischen Produktionsprozeß geschaffen, realisiert sich erst im Tausch. Werte werden so vergleichbar durch die abstrakt menschliche Arbeit die in ihnen steckt. In diesem Sinne ist der Kapitalismus nicht nur eine ungeheure Ansammlung von Waren sondern auch von Tauschprozessen. Der Tausch der Werte ist das omnipräsente Geschehen in der kapitalistischen Welt und der spezifische Charakter, den alle Gegenstände annehmen, nämlich Ware und Wert zu sein, durchdringt auch die allgemeine Qualität von Beziehungsformen zwischen Individuen. Auch diese (menschlichen Beziehungen) werden ihrer Struktur nach ins Warenfömige hinein überformt bzw. dahingehend destruiert und neu formiert. Allen Dingen innerhalb kapitalistischer Verhältnisse haftet so ein Fetischcharakter an, der Fetischcharakter des Werts bzw. der Waren. Der Austausch der Werte kann schließlich als eine den Raum der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft konstituierende spezielle Form der Wechselwirkung zwischen Individuen betrachtet werden. Damit stellt der Wert, wie er im Fetischkapitel (Kap. 1.4 in MEW23, /Marx88:85-98/) dargestellt wird, etwas ähnliches dar wie die Macht bzw. der Machtbegriff bei Foucault, wie er beispielsweise in »Mikrophysik der Macht« /FOUC76:114/ entworfen wird. Dieser Zusammenhang oder vielmehr der Vorgang des Verstehens dieses Zusammenhangs, dem Marx immerhin ein ganzes Unterkapitel widmet, so einfach er sich auch in kurzen Sätzen zusammenfassen läßt, begeistert die Apologeten und Adepten der Wertkritik. Erfreut darüber, diese Abstraktionsleistung vollzogen zu haben, wird die Tatsache der spezifischen Bedingtheit, der Beschaffenheit des kapitalistisch vergesellschafteten Raums als die zentrale Kategorie dargestellt und als eigentlicher Kern des Wesens des Kapitalismus postuliert, den es zu überwinden gilt. In diesem Zusammenhang wird gerne von einem »unbegriffenen« Vergesellschaftungszusammenhang gesprochen. Dies geschieht gebetsmühlenartig in fast jedem Artikel, Interview und Abstract, der uns aus Nürnberg (Krisis) und von anderswo zu diesem Thema erreicht (Siehe Bspw. /EDIT88:6/, /STAH88:38, 39/, /KURZ89:13/). Ernst Lohoff spricht in diesem Kontext von den Schönheiten der Wertformanalyse /LOHO88:63/.
Daß dieser gesellschaftliche Raum, der durch den Wert konstituiert wird, gerichtet ist, daß der Wert eine Fließrichtung hat, nämlich vom Produktionsmittelnichtbesitzer (ArbeiterIn) zum Produktionsmittelbesitzer (Kapitalist), die Tatsache also, das es Klassen gibt, wird von der Wertkritik als sekundäres- bzw. Oberflächenphänomen kapitalistischer Vergesellschaftung dargestellt oder wahlweise auch als Soziologismus denunziert (siehe /TOMA89:88/, /KURZ89:10, 12/).
Wer nicht nur über wertförmige Vergesellschaftung sonntäglich philosophieren und lamentieren will, sondern diese Vergesellschaftungsform ausgehend von ihrer Dichotomisierung in Klassen durch Klassenkampf beseitigen/aufheben will, der wird von Robert Kurz und anderen, gleich ob SozialdemokratIn, organisierte KommunistIn oder OperaistIn, als ewiggestriger Arbeiterbewegungsmarxist klassifiziert und abgestempelt.
Wertförmige Vergesellschaftung und subjektlose Herrschaft
Über Kritik, Scheitern und Integration der klassischen Linien der ArbeiterInnenbewegung brauchen wir mit den Wertkritikern keinen Disput auszufechten. Hier besteht im großen und ganzen Konsens. In dieser Hinsicht ist an der Kritik der Krisis-Gruppe am klassischen Arbeiterbewegungsmarxismus, an der Politik der II. und III. Internationale, der klassischen Arbeiterparteien, wenig auszusetzen. Die Konzeption der Theorie insgesamt wird allerdings unsinnig, wenn sie selbst die autonome Eigenbewegung der Klasse, auf welche sich beispielsweise der Operaismus (vgl. /RINA88:37/) bezogen hat, theoretisch negiert.
Wer mit Robert Kurz, Ernst Lohoff und ihren Gefolgschaften durch den Wald der Wertkritik zieht, bemerkt die Bewegung der Klasse nicht und das ist kein Zufall. Es ist gerade diese Bewegung der Klasse bzw. in ihrer verallgemeinerten Konzeption der Multitude (Negri), die das Kapital permanent in die Krise treibt, vor der das Kapital im Moment der Krise immer wieder ausweichen muß. Auch der Übergang vom Manchester Kapitalismus in den Sozialstaat am Ende des 19Jh. oder vom Fordismus zum Postfordismus, muß in dieser Hinsicht verstanden werden. Der Sozialstaat ist in erster Linie zu verstehen als Reaktion des Kapitals auf die sozialen Kämpfe, um die ArbeiterInnen wieder »einzufangen und produktiv einzuschließen« /BONE04:11/. In dieser Hinsicht ist auch der Übergang vom Fordismus mit tayloristischen Produktionsprozessen zum Postfordismus und der damit verbundenen sich durchsetzenden toyotistischen Organisation der Produktion zu verstehen. Hier geht es neben der Ausdehnung der Wertschöpfung auf alle (gesellschaftlichen) Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen der ArbeiterInnen auch darum eine bestehende politische Zusammensetzung der Klasse aufzubrechen und unter veränderten Arbeitsbedingungen neu bzw. modernisiert zu integrieren.
Die Wertkritik, genauer gesagt die Krisis (bis 1989 »Marxistische Kritik«) kann in diesem langen Verlauf von Klassenkämpfen und deren Integration nur die endgültige Disqualifikation von Klassenkämpfen an sich erkennen und diese nur im Sinne einer stabilisierenden Modernisierung und Verallgemeinerung des Systems dechiffrieren (vgl. /LOHO96:58/). Robert Kurz behauptet: »Somit kann der Klassenkampf nur die immanente Formbewegung des Kapitalverhältnisses sein, nicht aber die Bewegung zur Aufhebung des Kapitalverhältnisses« /KURZ96:45/. Damit ist genau das Kapitalverhältnis gemeint, dessen Totenglocken die Krisis Gruppe seit geraumer Zeit läuten sieht. Von der Überlegung, daß dieser Zustand des Systems durch soziale Kämpfe im allgemeinen und durch Klassenkämpfe im speziellen erreicht wurde, ist die Krisis-Gruppe weit entfernt. In den Texten der Krisis-Gruppe ist lediglich von objektiven Tendenzen der kapitalistischen Krise zu lesen. Diese Tendenzen sind in den Marxschen Begriffen der Überakkumulation und des tendenziellen Falls der Profitrate (vgl. z.B. /KURZ89b:12/), im Prinzip schon zusammengefaßt. Dazu kommt noch die in Krisis16/17 (/KURZ95:21/) diagnostizierte Himmelfahrt des Geldes, d. h. die Abkoppelung der (im bürgerlichen-ökonomischen Sinne) »Wert«schöpfung von der realen Verwertung menschlicher Arbeitkraft, welche den Imaginärteil des Geldes und damit auch seinen Nennwert (=Preis) in immer schwindelerregendere Höhen gleiten läßt. Dieser Sachverhalt ist im Prinzip auch nichts neues, auf die Tendenz der Entkopplung zwischen realer Verwertung und Geld machte Christian Marazzi bereits in den 70er Jahren, in dem Artikel: »Das Geld in der Weltkrise« /MARA77:241/ aufmerksam. Alle diese von der Wertkritik als »objektive Tendenzen« des Kapitalismus abgehandelten empirischen Tatsachen sind nicht zuletzt Ausdruck der sozialen Kampfsituation im Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit.
Wohingegen die Regulationsschule in ihrer Verbindung von Keynesianismus und Marxismus im Run durch die Akkumulationsregime von einem Findungsprozeß spricht, in dem soziale Kämpfe mitgedacht sind, reduziert die Wertkritik die Dynamik des Kapitalismus auf den Begriff des »automatischen Subjekts«. Es wird versucht - quasi aus der Vogelperspektive - eine Theorie des Kapitalismus außerhalb der realen Bewegungen der Klasse zu finden, was nach Karl Korsch (Marxismus und Philosophie, 1923) »einfache idealistische Metaphysik« wäre.
Auch wenn das Freiburger ISF die Krisis Gruppe nicht mag und Robert Kurz allen ernstes »Marxismus-Leninismus nur ohne revolutionäres Subjekt« /BRUH04:3/ vorwerfen, sie blasen an dieser Stelle in das selbe Horn der Hypostasierung des Kapitalismus als »automatisches Subjekt« (vgl. /BEHR01/). Der scheinbare Selbstlauf in der Entwicklung, Ausbreitung und Reproduktion des Kapitalverhältnisses, von Marx selbst an einer Stelle mit »automatischem Subjekt« /MARX88:169/ gekennzeichnet, kann in diesem Sinne nur funktionieren durch die permanente Fähigkeit des Kapitals die ArbeiterIn bzw. die ArbeiterInnenklasse anzukoppeln und einzubinden egal ob durch Gewalt und Zwang, Ideologie oder Partizipation, so autopoietisch der Prozeß kapitalistischer Verwertung und Vergesellschaftung auch scheinen mag. Gerade die Mechanismen Ideologie und Partizipation bzw. das Vertrauen der ArbeiterInnenklasse auf Partizipation funktionieren so perfekt, daß sie im Laufe der nationalkorporatistischen Klassenkämpfe auch im Bewußtsein der ArbeiterInnen tief verankert sind. Dazu kommt das Konkurrenzverhältnis nicht nur der ArbeiterInnen untereinander sondern auch der Kapitalisten untereinander, die bei Strafe ihres Untergangs permanent zur Reproduktion des Kapitalverhältnis dieses erneuern (Reinvestitionen) und modernisieren müssen, vor dem Hintergrund der konkreten Kampfsituation Kapital - Arbeit aber auch in Abgrenzung und Wettbewerb gegeneinander. Auf der Grundlage dieser Verhältnisse von kapitalistischer Vergesellschaftung zu sprechen ist sicherlich legitim, der Begriff »automatisches Subjekt« drängt sich einem geradezu auf, bringt das Projekt der Emanzipation jedoch derart falschverstanden und hypostasiert um nichts weiter. Die real existierende Wertkritik fetischisiert den Begriff des »automatischen Subjekts« und sieht praktisch nur noch ein Subjekt, das Kapital selber. Vor den Ruinen des reformistisch integrierten und stalinistisch verbrannten Klassenkampfs flüchtet die Wertkritik in eine Vorstellungswelt die den sozialen Antagonismus, die Existenz von Klassen nur als sekundäre Erscheinung, als Oberfläche kapitalistischer Vergesellschaftung sieht und alle sich darauf beziehende Theorie als »Klassenkampf-Fetisch« theoretisch entsorgt (vgl. /KURZ89:10/). Ein solcher Marxismus bemerke »gar nicht, daß er mit einer solchen Diktion völlig an einer Kritik der Fundamentalkategorien des Kapitals vorbeizieht« /KURZ89:11/. Und diese Fundamentalkategorie ist für die Wertkritik der Wert an sich und nichts weiter. Die Begriffe Mehrwert, Klasse und Subjekt spielen in dieser verschrobenen Metrik keine Rolle mehr. Damit wird aus dem Wert faktisch genau das was Robert Kurz den Poststrukturalisten und ihren Konzeptionen Macht (Foucault) und Text (Derrida) vorwirft, nämlich der Entwurf einer »Äthertheorie« /KURZ02:92/. So nimmermüde die Wertkritik die historisch-spezifische d.h. nicht ontologische Formbestimmtheit des Werts herausstellt, in ihrem theoretischen Gesamtentwurf ist kein Moment impliziert, das die Wertvergesellschaftung stoppen könnte außer, das Kapital (das einzige Subjekt, das die Wertkritik noch sieht) verschluckt sich »an sich selber«. Was Wertkritik nicht leistet, und somit auch gar nicht leisten kann: in den Krisenmomenten des Systems die Bewegungen der Klasse und nicht nur der Klasse sondern der Subjekte im allgemeinen sichtbar zu machen.
In diesem Sinne ist für Joachim Bruhns vom ISF die Sache klar: der Kapitalismus »wird scheitern, aber an sich selbst, an seiner inneren, an seiner logischen wie historischen Unmöglichkeit« /BRUH95:9/. Dann bräuchte man ja in der Zwischenzeit nur noch weiterarbeiten und abwarten bis das Kapitalverhältnis irgendwie von sich aus verdampft. Revolution als (intellektuelles) Pfingsterlebnis.
Um diesen »revolutionären« Attentismus zu legitimieren wird die im Prinzip strukturalistische Darstellung des Werts herangezogen, wie Marx sie im Fetischkapitel (Kapital Bd. 1 /MARX88:85-98/) erläutert. Aus ihm heraus wird die vermeintliche Oberflächlichkeit des Klassenverhältnisses abgeleitet und versucht zu begründen. Dies wird wie eingangs bereits erwähnt in nimmer müde werdender Emsigkeit von Artikel zu Artikel (Bsp. /EDIT88:6/, /STAH88:38, 39/, /KURZ89:13/) erklärt und ausgewalzt.
Dies kommt im Endeffekt einer Fetischisierung des Fetischkapitels bei Marx gleich. Der Begriff des Wertes als gesellschaftlicher Vermittlungszusammenhang wird hypostasiert, der Begriff des Wertes als analytische Kategorie, die Ausbeutung sichtbar machen kann und will (nicht umsonst nimmt sich Marx einige Kapitel im Kapital Raum, um den Wert der Arbeit dahingehend zu definieren) wird auf der Rückseite dessen fallen gelassen. Und mit der Ausbeutung werden dann die Klassen praktisch fallengelassen. An Stelle der Subjekte welche die Geschichte machen wird der Kapitalismus als automatisches Subjekt /KURZ90:105/, /LOHO90:136,147/ gesetzt (vgl. auch /ISF00:20/). Auch wenn es der Krisis-Gruppe und den Wertkritikern im allgemeinen sicherlich um die Überwindung des Kapitalismus geht, die Theorie, die sie dazu entfalten ist eine Theorie des Kapitals.
Wert und abstrakte Arbeit
Die Wertkritiker haben den Wert nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an...
Joachim Bruhns vom ISF in Freiburg geht in dieser Hinsicht noch »weiter«. Kurz wisse auch »nicht was das sein soll ‚Wert' , was das heißen soll: 'abstrakte Arbeit' und ‚automatisches Subjekt' [...] und zwar deshalb, weil Marx das nicht wußte, und deshalb, weil man das gar nicht wissen können kann. (sic!) Jede Rede vom Wert, die ihren Gegenstand als theoriefähigen Gegenstand faßt und also auf Definitionen bringt, ist nach Marx antikritisch und also Ideologie« /BRUH04:4,7/.
Hier wird - was den Begriff des Werts anbelangt - eine marxsche Kategorie, die im Sinne naturwissenschaftlicher Bestimmtheit nicht exakt positivistisch faßbar, nicht meßbar ist, komplett fallen gelassen und ihrerseits in ein positivistisch-philosophisches Nirvana aufgelöst. Das Freiburger ISF, von Lohoff/Kurz als »Hausmeister der Kritischen Theorie« /LOHO98/ bezeichnet, exerzieren uns vor, wie man auf dem Ticket kritischer Theorie, in der an sich lobenswerten Haltung, Kritik als normatives Konzept zu praktizieren (vgl. /ISF00:38-39/), den Standpunkt maximaler kritischer Kraft in Bezug auf die Konkreten materiellen (Herrschafts-) Verhältnisse verläßt. Das Frankfurter »Grandhotel Abgrund« (Lukacs) schrumpft in punkto Marxismus bzw. »Wertkritik« zur Freiburger »Pension Sackgasse«.
Bei der wissenschaftlich präzisierten Verwässerung der marxschen Begriffe Wert und abstrakte Arbeit stehen Krisis und ISF aber nicht alleine da. Michael Heinrich, der BRD-Schwarzgurt der Werttheorie kommt in dieser Hinsicht, was den Begriff des Werts bzw. den Begriff der abstrakten Arbeit (welche den Wert konstituiert) anbelangt, in seinen Anstrengungen bei dem Begriff »nicht substanzialistische-Substanz« /HEIN01/ zum Stillstand. Ein einziger Blick in die Warenwelt der Gegenwart läßt erkennen: abstrakte Arbeit und Wert sind - so konkret wie nur irgendetwas - Substanz! Trotz der Form der Darstellung der Ware und des Werts als gesellschaftliches Verhältnis /MARX88:85-98/ (vgl. auch /MARX87:30-31/) beschreibt Marx den Wert der Waren wie folgt.: »Betrachten wir nun das Residuum der Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen übriggeblieben als dieselbe gespenstische Gegenständlichkeit, eine bloße Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit, d.h. der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz sind sie Werte - Warenwerte« /MARX88:52/ (vgl. auch /MARX87:4/).
Auch die Zeitschrift Grundrisse aus Wien, welche im Editorial der 1. Ausgabe schreibt: »Letztlich sollen aber alle Beiträge in den Grundrissen dazu dienen, die Reflexion der gesellschaftlichen - geschichtlichen Entwicklung im Hinblick auf deren emanzipatorische Überwindung voranzutreiben« /EDIT02:3/ und Michael Heinrich in dankenswerter Weise dahingehend kritisieren, daß er mit seiner »strukturale[n] Methode [(vgl. /HEIN99:208ff/)], der er sich bedient, [...] zwar die wissenschaftliche Präzision« verbessere aber das Element der Praxis zugunsten dieser Wissenschaftlichkeit tilge bzw. verschweige /BIRK02:38/, tappen im Hinblick auf den Begriff des Werts in die gleiche Falle. In ihrem Artikel über abstrakte Arbeit schreibt Karl Reitter: »Mir ging es darum zu zeigen, daß einige Formulierungen, insbesondere die physiologische Definition der abstrakten Arbeit, die Verausgabung von Muskel, Nerv und Gehirn, zu unsinnigen und widersprüchlichen Konsequenzen führen müssen. Kurz gesagt liquidiert diese Fehldeutung die tiefe Geschichtlichkeit des Marxschen Denkens, sie verwischt die historischen Besonderheiten der sozialen Beziehungen im Kapitalismus und schreibt der Arbeit an sich die geradezu magische Fähigkeit zu, ‚Wert' zu produzieren. Damit ist der Weg verbaut, im Wert ein gesellschaftliches Verhältnis zu erkennen, und auch kritisieren zu können« /REIT02:16/. Immerhin muß man den Grundrissen aus Wien insgesamt zugute halten das sie das Problem der fehlenden Praxisimplikation dieser Werttheorie in der Auseinandersetzung mit Michael Heinrich erkannt haben. Davon ist die Krisis Gruppe noch weit entfernt. Ernst Lohoff (Krisis) bezichtigt, in genau dieser für die Wertkritik typischen undialektischen Haltung, die klassischen Marxisten, sie seien verliebt »in die Auflösung von Wert in menschliche Arbeit« und würden sich so systematisch den Weg zur Wertformanalyse vermauern /LOHO88:63/. In völliger Kohärenz dazu bemerkt das ISF, daß »die Rede von abstrakter Arbeit als wertstiftend durch Energieverausgabung irreführend [sei], denn diese bestimmt weder Form noch Größe des Werts einer Ware« /ISF00:34/ und statt dessen sei der »Wert als Inbegriff der Vermittlung der sozialen Totalität« /ISF00:33/ zu begreifen.
Angesichts dieser, in einseitiger Hinsicht auf die gesellschaftlichen Strukturen bildende Eigenschaft des Werts abzielenden Haltung, fragt es sich, ob es tatsächlich so schwer sein kann, für Leute die eigentlich Wissen was Dialektik bedeutet, in Widersprüchen zu denken und dabei noch hinter die Abstraktionsfähigkeit der positivistischen Wissenschaften - beispielsweise der Physik - am Anfang des 20. Jahrhunderts zurückzufallen. Es ist heutzutage eine Binsenweisheit der Quantentheorie, daß ob Elektronen oder Licht, beide können Welle oder Teilchen sein. Es gibt zahllose Experimente und Naturerscheinungen deren korrekte Beschreibung im Teilchenbild gelingt und ebenso zahllose deren korrekte Beschreibung im Wellenbild gelingt. Dieser Widerspruch ist bis heute nicht dialektisch aufhebbar, ohne das sich noch irgendein Naturwissenschaftler daran stört. Wieso soll also der Wert (auch als historisch-spezifische, nicht-ontologische Kategorie) nicht ein Ding sein, in dem menschliche Arbeit angehäuft ist und gleichzeitig ein den Raum der kapitalistischen Gesellschaft konstituierende Form darstellen. Gerade die nicht von der Hand zu weisenden Oszillationen in der Marxschen Art der Darstellung des Werts sind als Versuch zu sehen zwischen diesen Polen begrifflich zu vermitteln ohne dabei den einen oder den anderen Aspekt fallen zu lassen. Der Begriff »abstrakte Arbeit« mit all seinen Implikationen ist ein Ausdruck der theoretischen Anstrengungen Marx' diese Stereophonie begrifflich auf einen Nenner zu bringen.
Der lachende Dritte dieser verkürzten »Wertkritik« und dieser »Wissenschaft vom Wert« sind die bürgerlichen Ökonomen und deren Ideologie mit ihren verdinglichten Kategorien wie beispielsweise »Lohn« und »Gewinn« die es ja, so sollte man meinen, mit den Begriffen v (variables Kapital) und m (Mehrwert), zu desavouieren und zu destruieren gilt. Trotz der Vielschichtigkeit der Marxschen Argumentation, ein zentrales Anliegen seiner Arbeiten in der »Kritik der bürgerlichen Ökonomie« war es, im Kapitalverhältnis Ausbeutung als analytische Kategorie, über das moralische hinausgehend, sichtbar und benennbar zu machen.
Dichotomie von Gebrauchswert und Tauschwert und soziale Praxis
Ein weiteres Problem, welches die »Wertkritik« schafft, ist die apodiktische Setzung der Trennung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Selbstverständlich ergeben diese von Marx aufgezeigten Kategorien, nicht nur hinsichtlich der historischen Entstehung kapitalistischer Produktionsverhältnisse einen Sinn. Natürlich geht es letztendlich um die Zurückführung der Ökonomie in die Gesellschaft (Polanyi) und somit um die Aufhebung kapitalistischer und in diesem Sinne warenförmiger Vergesellschaftung. Die apodiktische Trennung dieser letztlich auch zusammengehörenden Formen Tauschwert und Gebrauchswert (es gibt keinen Tauschwert ohne Gebrauchswert) steht der Praxis der Aneignung von Produktionsmitteln und der Übernahme der Produktion in ArbeiterInnenselbstverwaltung welche innerhalb der Verhältnisse kapitalistischer Vergesellschaftung zwangsläufig beginnen müssen, aber theoretisch im Wege (vgl. /KURZ86/, /LOHO88:59-65/). Dazu ein Beispiel:
Derzeit sind in Argentinien und Brasilien hunderte von Fabriken besetzt. Der Umstand innerhalb einer kapitalistischen Gesamtumgebung in ArbeiterInnenselbstverwaltung zu produzieren, was in dieser Hinsicht insbesondere über die Sphäre der Vermittlung und den in diesem Zusammenhang möglicherweise stattfindenden ungleichen Tausch auch Selbstausbeutung bedeuten kann, stellt selbstverständlich ein Problem dar.
Auch wenn das Kapitalblatt »The economist« (9.11.2002) gelassen bemerkt, daß »diese Bewegung keine Bedrohung für kapitalistische Unternehmen darstellt« so wird doch eingeräumt, dass man von einer »Erosion der Eigentumsrechte« sprechen kann. Die Besetzungen, so wird aus Argentinien berichtet »entstehen als Überlebensprojekt in einer defensiven Situation.
Aber sie werfen Fragen auf, die weit über das unmittelbare Ziel, den Erhalt der eigenen Arbeitsplätze, hinausgehen. Mehr als 10.000 ArbeiterInnen stellen zur Zeit in Argentinien das Privateigentum praktisch in Frage, und sie müssen sich teilweise handgreiflich gegen die Staatsgewalt durchsetzen. Sie machen die Erfahrung, daß sie in der Lage sind, die Produktion selbst zu organisieren. In der Fabrik ohne Chefs ist plötzlich nichts mehr selbstverständlich, nichts muß als gegeben hingenommen werden. Es gibt keine Vorarbeiter und Meister mehr; die ArbeiterInnen verändern Arbeitszeiten und -organisation entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse und entscheiden in Versammlungen, was und wie produziert wird. Nicht mehr Profit und Gewinnmaximierung sind das Ziel der Produktion, sondern Einkommen für möglichst viele Menschen und die Herstellung nützlicher Dinge unter erträglichen Bedingungen« /BEIL04:26/. Trotz alledem stehen die ArbeiterInnen, die sich z.T. rätedemokratisch organisieren (vgl. /FERN03/), mit ihren Fabriken in einem gesamtgesellschaftlich-kapitalistischen Kontext, der die beschriebenen neu gewonnen Freiheiten begrenzt und einschränkt. Dieses Problem, dem sich die ArbeiterInnen zweifelsohne bewußt sind, wird aber nicht kleiner wenn die ArbeiterInnen vor oder während der Fabrikbesetzung das Fetischkapitel im Kapital Band 1 lesen oder die Krisis im Abo beziehen und damit einerseits über die vermeintliche Totalität wertförmiger Vergesellschaftung und andererseits über den soziologisch oberflächlichen Charakter dessen was sie da gerade tun - nämlich als Klassensubjekte zu kämpfen - informiert sind. So aufschlußreich und erhellend das Verständnis um den Fetischcharakter der Waren ist, er bringt den Prozeß der Emanzipation in dieser Hinsicht nur mittelbar weiter. Würde man jedoch das von der Wertkritik aufgespannte Theoriegebäude hier konsequent zur Anwendung bringen, so könnten die ArbeiterInnen aus den Fabriken ruhig wieder rauskommen weil sie dort natürlich Produkte herstellen, die weniger den Charakter von Gebrauchswerten sondern eher den von Tauschwerten hätten. Sie hätten dann entlang der wertkritischen Hypostasierung des Fetischcharakters der Waren und der letztlich noch nicht geknackten Warenform ihrer Produkte (nämlich immer noch Tauschwerte zu sein) den kapitalistischen Vergesellschaftungszusammenhang bzw. den »fetischistischen Ware-Geld Nexus« /KURZ90:115/ noch nicht einmal auf ihrem eigenen Terrain angekratzt. Auch an diesem einfachen Beispiel wird die Sprödheit der theoretischen Metrik der Wertkritik sichtbar, sie hat in der von der Krisis-Gruppe oder dem ISF konzipierten theoretischen Gesamterscheinung keine Praxisimplikation.
Marx beschreibt im Kapital zurecht, daß sich der Gegensatz zwischen Gebrauchswert und Tauschwert auch mit dem Gang der technologischen Entwicklung vertieft hat. Ist »Große Maschinerie« erst einmal durchgesetzt (so gewaltsam dieser Prozeß auch gewesen sein mag), so wird auch unter Bedingungen einer nur in etwa zu antizipierenden ArbeiterInnenselbstverwaltung der Produktion ein zurück zur klassischen Subsistenzwirtschaft wohl kaum wünschenswert sein und die damit verbundene Produktion von phasenreinen Gebrauchswerten wird es in diesem Sinne in »entwickelten« Gesellschaften nicht oder kaum mehr geben. Dennoch stellen die Fabrikbesetzungen wie sie derzeit in Argentinien und Brasilien von statten gehen sicherlich einen Bruch mit dem Schema G - W - G (Geld - Ware - Geld) und insbesondere G - W - G', hin zur eigentlichen Tauschform W - G - W dar. Nach ihrem stofflichen Inhalt ist das die Bewegung W - W (vgl. /MARX88:120/). Marx stellt diese Bewegung in seiner Schrift »Zur Kritik der politischen Ökonomie« folgendermaßen dar:» Betrachten wir nun das Resultat von W - G - W, so sinkt es zusammen in den Stoffwechsel W - W. Ware ist gegen Ware, Gebrauchswert gegen Gebrauchswert ausgetauscht worden, und die Geldwerdung der Ware, oder die Ware als Geld, dient nur zur Vermittlung des Stoffwechsels. [...] Das Geld ist nur das Mittel und die bewegende Kraft, während die dem Leben nützlichen Waren das Ziel und der Zweck sind« /MARX90:77/.
Der Tausch von »Waren« ob mit oder ohne Geld (vgl. Allgemeine Wertform /MARX88:79/ und Geldform /MARX88:84/) wird sicherlich auch in einer nachkapitalistische Ära noch von statten gehen. Keine ArbeiterIn und kein Kollektiv wird gleichzeitig Keramikkacheln, Lebensmittel und Eisenbahnwaggons herstellen. Trotzdem ist jede besetzte Fabrik ein Schritt zur Destruktion des Geldes in seiner Funktion als schärfster und unmittelbarster Kommandoform Arbeit in Wert zusetzen. Dieser Kampf in der sich entwickelnden ArbeiterInnenautonomie, so eingezwängt in den Kapitalistischen Gesamtzusammenhang er auch immer sein mag, wird automatisch, ausgehend von der eigenen Subjektivität der ArbeiterIn, auch ein Kampf gegen die Arbeit als entfremdete Arbeit sein. Es wird sich ein neuer Typus von Produkten/»Waren« bilden, der in den Marxschen Kategorien von Gebrauchswert, Tauschwert und Wert nur noch bedingt abbildbar ist. Dieser Prozeß ist offen. Die Wertkritik blockiert jedoch theoretisch mit ihrer apodiktischen Setzung der Trennung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert (es gibt kein richtiges Leben im Falschen) und dem starren positiv/negativ Bezug auf den Gebrauchswert/Tauschwert den Prozeß der Aneignung und des Kampfes um selbstbestimmte Produktion der im Beispiel der Fabrikbesetzungen in Argentinien auch ein Kampf der ArbeiterInnen ist, ihr überleben zu sichern.
Der Vorschlag von Marx - wenngleich fußend auf den bürgerlichen Ökonomen Ricardo - den Wert einer Ware über die in ihr steckende Arbeitszeit zu messen, kann auch für die nachkapitalistische Ära, in der die Produktion unter ArbeiterInnenselbstverwaltung nach tatsächlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist, von Bedeutung sein, wenn es daran geht, verschiedene hergestellte oder herzustellende Produkte, in Kontrast zur subjektiven Wertlehre und zum Nutzenkalkül der Neoklassik, gerecht zu bewerten bzw. zu vermitteln. Die von Marx explizit als historisch-spezifisch konzipierte Kategorie des Werts von Waren bzw. von Produkten könnte in diesem Sinne durchaus überhistorische Qualität gewinnen, d. h. über den kapitalistischen Vergesellschaftungszusammenhang hinausweisen (vgl. dazu auch /HAUG76:119/).
Das entscheidende ist, neben den Eigentumsverhältnissen, das Kommando über den Mehrwert der in den Betrieben geschaffen wird. Liegt dieses Kommando bei den ArbeiterInnen, die ihn erarbeitet haben und gibt es in diesem Sinne keine Klassen mehr, so ist dem »Wert« sofern man dann überhaupt noch von »Wert« reden kann, der dämonische Charakter genommen - der Kapitalismus ist erloschen. Daß einige hundert besetzte Fabriken noch keine Revolution bedeuten ist eine triviale Feststellung. Die Menschen setzen sich jedoch nicht nur in Argentinien und Brasilien gegen Ausbeutung zur wehr, sie tun dies überall und in den verschiedensten Formen. An den so gesetzten Praxispunkten im Antagonismus Kapital Arbeit gilt es diese Bewegungen theoretisch/kritisch und auch begrifflich zu flankieren und dahingehend zu radikalisieren, daß die Subjekte den kapitalistischen Gesamtzusammenhang erkennen und die lange Geschichte reformistischer Integration unters Kapitalverhältnis durchbrechen. Dies gilt gerade auch für die Situation in den Metropolen. In diese Richtung hat die freundliche Fratze des janusköpfigen Spätfordismus einiges an falschem Bewußtsein erzeugt und hinterlassen.
Die inhärenten Widersprüche der »Wertkritik«
Eine dennoch verbleibende Restsympathie für die Krisis-Gruppe speist sich einzig und allein aus ihren eigenen Widersprüchlichkeiten. Es scheint als würde ihnen, im Gegensatz zum Freiburger ISF irgendwie dämmern, das ihre Theorie insgesamt den Raum einer »revolutionären« Wartehalle aufspannt. Im Verlauf dieser Dämmerung kommen sie zu seltsamen Vorstellungen. Wie bereits geschildert negieren Kurz/Lohoff und andere die Kategorie des (revolutionären) Subjekts insgesamt. Der Ausweglosigkeit dieser Konstruktion scheinen sie sich dennoch irgendwie bewußt zu sein und sie phantasieren sich in ihrer enormen Schreibwut - quasi als (virtuellen?) Ersatz - eine »Antiklasse« /KURZ89:38-41/ herbei, welche den kapitalistischen Wertvergesellschaftungszusammenhang, den Ware-Geld Zusammenhang (vgl. /KURZ90:115/) irgendwie zerstören soll. Gleichzeitig denunzieren sie aber linksradikale Bezüge wie z.B. die der »Autonomie Neue Folge« auf die Kämpfe im außerkapitalistischen Milieu bzw. an den Rändern der Inwertsetzungszonen. Diese Kurz/Lohoffsche Kategorie der Antiklasse ist so nicht haltbar. Wenn es »innerhalb« der kapitalistischen Zusammenhangs keine Subjekte mehr geben kann und auch der Bezug auf die Kämpfe im außerkapitalistischen Milieu negiert wird, woraus könnte denn so eine »Antiklasse« entspringen? Der schwäbische Autonome, der in Kreuzberg bei Kaisers die Sonderangebote klaut oder was soll das sein? Nichts gegen den Bezug auf neue soziale Bewegungen und den Prozeß der Aneignung aber dann kann das auch so benannt werden. Aus den Texten der Krisis-Gruppe geht jedoch deutlich hervor, daß sie weder die Autonomen (/EDIT86/) noch die Zeitschrift »Autonomie NF« (vgl. /TOMA89:86/) besonders schätzen.
Ein besonderes Schmankerl ist dann noch die Tatsache, daß sich auf der von positiven Bezügen auf revolutionäre Subjekte und Klassenkampf ansonsten gründlich gesäuberten Homepage der Krisis ein Link zur Wildcat-Homepage, zum eigentlich, so sollte man meinen, dreifach verbotenen Hort des Operaismus und des Klassenkampfs in der BRD findet. Hier beißt sich die Katze endgültig in den Schwanz und es scheint als wären den Gehirnen der »Wertkritiker«, in ihrer »theoretischen Wartehalle der Revolution« beim hegelianischen Formbestimmen des Werts und dem langen Warten auf den großen Knall, mit der Zeit doch Zweifel am eigenen theoretischen Entwurf eindiffundiert.
Wenn die Krisis, den Klassenkampf nur im Sinne einer systemimmanenten Verallgemeinerung und Ausweitung sprich Modernisierung des Kapitalismus dechiffrieren können (vgl. /LOHO96:58,59/), dann stellt die Aussage, daß der »wertimmanente Interessenkampf« /LOHO98/ nicht einfach preiszugeben sei einen kategorialen Widerspruch dar. Von der Einsicht jedenfalls, daß proletarisches Handeln in seiner ganzen Widersprüchlichkeit »kapitalimmanent und systemüberwindend zugleich sein kann« /HÜTT95:19/ und das eine bloße Gemeinschaft der Einsichtigen, den Wertvergesellschaftungszusammenhang des »automatischen Subjekts« durchschauenden, als »praktische soziale Bewegung« /KURZ04:5/ etwas dürftig ist, scheint die Krisis-Gruppe noch weit entfernt zu sein.
Schluss
Wenngleich der Wert der Waren über die menschliche Arbeitszeit, die darin verausgabt ist, exakt im positivistisch-naturwissenschaftlichem Sinne nicht meßbar, nicht quantifizierbar ist, verwendet Marx doch einige Kapitel im Kapital darauf den Wert von Waren in diesem Sinne zu definieren. In den Begriffen des variablen Kapitals und des Mehrwerts findet die Überlegenheit der marxschen Kritik gegenüber der bürgerlichen Ökonomie ihren Ausgangs- und Kernpunkt. In diesem Sinne ist die Kategorie des Wertes die Kategorie mit der die bürgerliche Ökonomie kritisiert wird. Neben der Tatsache der Raumkonstitution durch den Wert wird dadurch Wertraub bzw. Ausbeutung sichtbar und begreifbar. Wichtiger noch als die Gewißheit, daß Wert- und Warenaustausch den Raum der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft strukturieren, ist die Tatsache, daß durch den damit faktisch verschränkten Wertraub (Ausbeutung) und durch die so bedingte Akkumulation des Kapitals, Herrschaft konstituiert wird. Diese Verschränktheit der Marxschen Kategorien, wie sie sich auch in der Darstellung der »Kritik der bürgerlichen Ökonomie« in ihrer Gesamtheit, feststellen lassen, muß theoretisch sichtbar bleiben. In dieser Hinsicht marxsche Kategorien gegen das Kapitalverhältnis Arbeit und Kapital oder konkreter noch Arbeiter und Kapital (Tronti) permanent in Stellung zu bringen muß Aufgabe jeder linksradikalen, marxistischen und sozialrevolutionären Theorie und Praxis sein.
Quellen:
/BEIL04:26/ »Eine Fabrik in Patagonien - Zanon gehört den Arbeitern« in: Beilage zur Wildcat 68(2004)26.
Weitere Quelle (nicht in der ursprünglichen Printausgabe dieses Textes angegeben):Argentinien: Räumung verhindert - Zanon gehört den Arbeitern!
/BEHR01/ Jürgen Behre / Nadja Rakowitz »Automatisches Subjekt?« Vortrag zur Roten Ruhr Uni 15.11.2001 www.isf-freiburg.org/beitraege/BehreRakowitz_AutomatischesSubjekt.htm Seite besucht am 5.3.2004
/BIRK02:38/ Martin Birkner, »Der schmale Grat« in: Grundrisse, Zeitschrift für linke Theorie & Debatte 1(2002)3 Wien
/BONE04:11/ Werner Bonefeld, »The downward spiral« in: Wildcat 68(2004)11
/BRUH04:X/ Joachim Bruhn, »Derivatenhändler der Kritik«, (Zuerst erschienen in Bahamas) www.isf-freiburg.org/beitraege/Bruhn_Kurz.htm Seite besucht am 5.3.2004
/BRUH95:9/ Joachim Bruhns, »Karl Marx und der Materialismus«, (Vortrag Jour Fixe 17.10.1995 und Rosa Luxemburg Gesellschaft Mannheim 15.12.1995) www.isf-freiburg.org/beitraege/Bruhn_Materialismus.htm S.9 Seite besucht am 5.3.2004
/EDIT86/ Editorial, Marxistische Kritik 1(1986) Verlag Marxistische Kritik Erlangen
/EDIT87:3/ Editorial, Marxistische Kritik 3(1987)3 Verlag Marxistische Kritik Erlangen
/EDIT88:6/ Editorial, Marxistische Kritik 5(1988)6 Verlag Marxistische Kritik Erlangen
/EDIT02:3/ Editorial, Grundrisse, Zeitschrift für linke Theorie & Debatte 1(2002)3 Wien
/FERN03/ Marco Fernandes, »Sei dein eigener Chef !« in: Dossier Jungle World 33(2003)
/FOUC76:114/ Michel Foucault, »Mikrophysik der Macht« (1976)114 Merve Verlag Berlin
/HAUG76:119/ W. F. Haug, »Vorlesungen zur Einführung ins ‚Kapital'«, Pahl-Rugenstein, Kleine Bibliothek 45, 2. Aufl. (1976)119
/HEIN99:208ff/ Michael Heinrich, »Die Wissenschaft vom Wert«, (1999)208ff Verlag Westfälisches Dampfboot, 2. Durchges. Auflage Münster 2001
/HEIN01/ Michael Heinrich, Seminarplan »Krise und Staat in Marx' Kritik der politischen Ökonomie« Sommersemester 2001, FB Politik und Sozialwissenschaften FU Berlin
/HÜTT95:19/ Bernd Hüttner, »Die ‚Wiederkehr der Proletarität' - Neuer klassenanalytischer Ansatz oder ökonomistische Fata Morgana« in: Göttinger Nachrichten 171(1995)19, übernommen aus Zeitschrift »Z« 21(1995)
/ISF00:X/ Initiative Sozialistisches Forum, »Der Theoretiker ist der Wert«, ca ira-Verlag, Freiburg (2000)
/KURZ86/ Robert Kurz, »Die Krise des Tauschwerts« in: Marxistische Kritik 1(1986)Kapitel 2 Verlag Marxistische Kritik Erlangen
/KURZ89:XX/ Robert Kurz / Ernst Lohoff, »Der Klassenkampf-Fetisch« in: Marxistische Kritik 7(1989)XX Verlag Marxistische Kritik Erlangen
/KURZ89b:12ff/ Robert Kurz, »Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff« in: Marxistische Kritik 6(1989)12ff Verlag Marxistische Kritik Erlangen
/KURZ90:105/ Robert Kurz, »Aschermittwoch des Marxismus« in: Krisis 8/9(1990)105 Krisis Verlag Erlangen
/KURZ95:21/ Robert Kurz, »Die Himmelfahrt des Geldes« in: Krisis 16/17(1995)21, Horlemann Verlag Bad Honnef
/KURZ96:45/ Robert Kurz, »Die letzten Gefechte« in: Krisis 18(1996)45, Horlemann Verlag Bad Honnef
/KURZ02:92/ Robert Kurz, »Blutige Vernunft« in: Krisis 25(2002)92, Horlemann Verlag Bad Honnef
/KURZ04:XX/ Robert Kurz, »Marx lesen, Die wichtigsten Texte von Karl Marx für das 21. Jahrhundert«, www.giga.or.at/others/krisis/r-kurz_marx-lesen_buch.html, Seite besucht am 20.02.2004
/LOHO88:XX/ Ernst Lohoff, »Der Zusammenbruch einer Zusammenbruchstheorie - Henryk Gross-mann und die Marxschen Reproduktionsschemata« in: Marxistische Kritik 5(1988)XX, Verlag Marxistische Kritik Erlangen
/LOHO90:136,147/ Ernst Lohoff, »Die inflationierung der Krise« in: Krisis 8/9(1990)136,147 Krisis Verlag Erlangen
/LOHO96:58/ Ernst Lohoff, »Determinismus und Emanzipation« in: Krisis 18(1996)58 Horlemann Verlag Bad Honnef
/LOHO98/ Ernst Lohoff, Robert Kurz, Interview in der Zeitschrift Marburg-Virus (1998)
/MARA77:241/ Christian Marazzi, »Das Geld in der Weltkrise« in: Zerowork 2, Thekla10(1977)241
/MARX87:XX/ Karl Marx, »Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des ‚Kapitals' (Dezember 1871 - Januar 1872)« in: Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung: »Das Kapital und Vorarbeiten« Band 6 (II/6), (1987) Dietz Verlag Berlin
/MARX88:XX/ Karl Marx, »Das Kapital« Band 1 in: Marx-Engels Werke 23(1988)XX Dietz Verlag Berlin
/MARX90:77/ Karl Marx, »Zur Kritik der politischen Ökonomie«, in: Marx-Engels Werke 13(1990)77 Dietz Verlag Berlin
/REIT02:16/ Karl Reitter, »Der Begriff der abstrakten Arbeit« in: Grundrisse, Zeitschrift für linke Theorie & Debatte 1(2002)16 Wien
/RINA88:37/ Paola Rinaudo, »Die große Fabrik: Fiat Turin, Eine Fallstudie« in: Arbeiter/innenmacht gegen die Arbeit - Eine Autonomie Anthologie (1988)37 Hrsg. Coup d' Etat Freiburg i. Br.
/STAH88:38,39/ Johanna W. Stahlmann, »Der unsichtbare Sozialismus«, in: Marxistische Kritik 5(1988)38, 39 Verlag Marxistische Kritik Erlangen
/TOMA89:86/ Nuno Tomazky (= Norbert Trenkle), »Militanter Empirismus und IWF-Kampagne«, in: Marxistische Kritik 6(1989)86 Verlag Marxistische Kritik Erlangen
... link (5 Kommentare) ... comment
http://www.testticker.de/news/portables/news20060228025.aspx
... link (0 Kommentare) ... comment
Meister Shorin Tanaka sagte gar nichts, sondern aß weiter. Eine Fliege summte an ihm vorbei. seine Eßstäbchen zuckten nach oben, und ohne hinzusehen, zerquetschte er die Fliege zwischen ihren Spitzen. Dann nahm er das Fischmesser, welches neben seinem Teller lag, und warf es mit einer beiläufigen Bewegung an einen der hölzerne Türpfosten. Die Klinge verschwand bis zum Heft im massiven Teakholz. Meister Tanaka wischte die Eßstäbchen sauber und setzte seine Mahlzeit schweigend fort. Er brauchte nicht aufzublicken, um zu wissen, dass die drei Räuber gegangen waren.
Der beste Kampf ist der, der nicht stattfindet.
... link (0 Kommentare) ... comment
... link (0 Kommentare) ... comment
... link (1 Kommentar) ... comment
http://blog.handelsblatt.de/indiskretion/eintrag.php?id=595#k6395962
... link (0 Kommentare) ... comment
Berlin, 27.2.06
Heute - am 27.2.06 - wurde bekannt, dass die Polizei im Jahr 2004 monatelang die Telefone zweier Journalisten in Wolfsburg sowie die der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" (WAZ) kontrollieren und die Verbindungsdaten ermitteln ließ. Wie die Zeitung mitteilt, suchte die Polizei nach "Indizien für ihren diffusen Verdacht, Mitarbeiter der WAZ hätten Polizeibeamte bestochen, um an Informationen zu kommen. Der Verdacht hat sich als haltlos erwiesen, die entsprechenden Verfahren wurden eingestellt."
Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di protestiert nachdrücklich gegen diese Verletzung der grundgesetzlich geschützten Vertrauensbeziehung zwischen Journalisten, Redaktionen und ihren möglichen Informanten ohne hinreichenden oder triftigen rechtsstaatlichen Grund.
"Damit wird der Vertrauensschutz von Informanten gegenüber der Presse und zugleich der grundgesetzlich garantierte Schutz der Presse vor staatlicher Aufsicht und Gängelung zerstört," so Manfred Protze, Sprecher der dju in ver.di. Auch in diesem Fall wurde wieder der Versuch unternommen, über die Telekommunikationsdaten von Journalisten an die von den Ermittlungsbehörden gewünschten Informationen heranzukommen. Das zeigt erneut die von der dju seit Jahren gerügte Gefahr gesetzlicher Erlaubnisse in einer Grauzone. Sie ermöglichen die Umgehung von Verboten und bieten damit keinen ausreichenden Schutz für Informanten und Journalisten.
"Es gilt nach wie vor: Die Pressefreiheit existiert entweder ungeteilt oder sie existiert nicht. Wer Rechte der anderen nicht verteidigt, setzt die eigenen aufs Spiel. Nicht nur die SPIEGEL-Affäre hat gelehrt, dass die Pressefreiheit ein latent gefährdeter Pfeiler der Demokratie ist. Er bedarf unter dem Motto "Wehret den Anfängen!" der stets aufmerksamen Verteidigung", so Manfred Protze.
... link (2 Kommentare) ... comment
... link (6 Kommentare) ... comment
Dennoch muss ich (ich habe gerade eine besinnliche Zeit, in der alte Erinnerungen hochkommen) eingestehen, dass auch ich nicht frei von Schuld bin. Es ist schon eine Weile her, ich weilte mehrere Tage in HH und übernachtete dort bei der K. Deren Mitbewohnerin war nicht anwesend, und so konnte ich deren Zimmer benutzen. Nun hatte ich mir Arbeit mitgebracht, brauchte also einen Rechner, und als praktizierender Anhänger großer Workstations besaß ich schon lange kein Notebook mehr. Die K. meinte, ihre Mitbewohnerin (die fing auch mit K an, ich nenne sie also hinfort K2) hätte sicher nichts dagegen, wenn ich ihren Rechner benutzte. Das tat ich dann auch. Dabei stieß ich auf eine Merkwürdigkeit.
K2 hatte ihre Daten nicht nur durch kein Password gesichert, Sie ließ alles ungeordnet im Wurzelverzeichnis herumliegen. Es passierte mir wiederholt, dass ich versehentlich eine ihrer Dateien öffnete, die ich dann ärgerlich wieder wegklickte. Am zweitenAbend, es war schon ziemlich spät, blieb ich dann irgendwann hängen und las einen Text, eine politische Rede für eine Kundgebung. Ich wusste, dass das nicht in Ordnung war, aber ich las erneut weiter, als ich ein weiteres Mal eine Word-Datei öffnete, die so ähnlich hieß wie ein von mir abgespeicherter Text, aber eine Art Tagebucheintrag der K2 war. Sehr schnell ereignete sich der Sündenfall zum Stalker: Ich las über eine Stunde lang in ihren Aufzeichnungen, die in einer warmen, sympathischen facettenreichen Farbe geschrieben waren, und erfuhr dabei sehr viel über sie, ihre Vorlieben, ihre Ängste, ihren Geschmack, insbesondere auch darüber, worauf sie so bei Männern steht. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich den Rechner abschaltete, aber ich war auch hin- und hergerissen vom Interesse an dieser offensichtlich faszinierenden Frau, deren Texte eine außerordentliche innere Schönheit offenbarten.
Dass von äußerer Schönheit auch die Rede sein konnte, offenbarte sich am nächsten Abend, als die K2 nach Hause kam. Diese hatte schon sehr viel von mir gehört, kannte die meisten meiner Texte und war, wie sie erzählte, schon lange sehr daran interessiert, mich kennenzulernen.
Da ich auf diese Frau nun meinerseits ziemlich abfuhr, machte ich ihr den Hof, warf mit Komplimenten um mich, baggerte, was das Zeug hielt und machte auch bedenkenlos von meinem Herrschaftswissen Gebrauch, das auf ihrer Festplatte lag. Wo immer ich wusste, dass sie an dieser Stelle nun dies erwartet oder gerne gehört hätte, setzte ich es konsequent ein. Irgendwann kam die K, um mir mitzuteilen, dass sie mir die Couch im Wohnzimmer bezogen hätte, da die K2 ja nun wieder ihr Zimmer bräuchte, aber da war längst klar, wer mit wem in wessen Bett die Nacht verbringen würde.
- Es wurde daraus eine One-Weekend-Love-Affair, nichts Größeres, aber in jeder Beziehung wunderbar.
Ich richtete mich auch beim Sex sehr genau nach dem, was sie laut ihren Aufzeichnungen haben wollte, hier ein Biß ins Ohr, dort ein Fingernagel auf der Wirbelsäule, da ein Kniff in den Hintern, wenn sich gerade ihr Atem beschleunigte...
Nur hatte ich hinterher ein schlechtes Gewissen, ohne sagen zu können, dass ich mein Handeln bedauerte. Irgendwann fasste ich Mut und rief die K2 an, um ihr alles zu gestehen. Ich stammelte ziemlich lang und dumm herum, bis ich zum Punkt kam.Ich war sehr zerknirscht. Da sagte die K2: "Zwischen uns gibt es kein wirkliches Problem. Mich nerven One-Night-Stands mit Männern, die das Falsche sagen oder Reize spielen lassen, die mich nicht ansprechen oder mich mackermäßig beeindrucken wollen. Ich habe also nachgeholfen. Du hast genau die Dinge gemacht, die ich als Handlungsanweisungen auf meinem Rechner hinterlassen habe."
tit for tat, kann man nur sagen.
... link (7 Kommentare) ... comment
Unternehmer sollen Anstand zeigen und keine Leute entlassen, fordern nicht nur Linke. Das ist unpolitisch: So kommt es nie zu Gerechtigkeit, die Chefs können sich freuen
Die Öffentlichkeit ist empört. DaimlerChrysler streicht 8.500 Stellen, die Telekom gleich 32.000. AEG wandert von Nürnberg nach Polen und hinterlässt 1.750 Mitarbeiter ohne Job. Der Reifenhersteller Conti schließt einen Standort in Hannover, 320 Arbeitsplätze entfallen. Dabei konnte der Konzern schon in den ersten neun Monaten einen Rekordgewinn von 1,2 Milliarden Euro melden.
Neue Meinungskoalitionen bilden sich. Ulrich Greiner in der Zeit ist so entsetzt darüber wie die Bild-Zeitung, dass Firmen Stellen reduzieren, obwohl sie Gewinn machen - nur um ihre exorbitanten Erträge noch weiter zu steigern. Allseits wird "Anstand" bei "den Unternehmern" vermisst. Eine Gegenstrategie gibt es ebenfalls: Auch taz-Leser rufen zu Kundenboykotten gegen die ruchlosen Firmen auf.
Sie meinen es alle gut. Doch ohne auch nur zu stocken, eilen Linke und nicht so linke Empörte in eine neoliberale Falle. Die Enttäuschten regen sich zwar über einige Chefs ohne "Anstand" auf, aber das tun sie nur, weil sie an den guten Unternehmer glauben, der für Gerechtigkeit sorgen soll. Der Staat kommt nicht mehr vor - das ist genau das FDP-Konzept. Der moralische Appell an die Firmenchefs ist eine Entpolitisierung, die hochpolitisch ist. Die Mächtigen profitieren, wenn man sie für allmächtig hält.
Zudem läuft die Empörung ins Leere: Moral kann sich nur gegen Täter richten. Doch wer sind "die Unternehmer"? Sie sind nicht fassbar. Beispiel DaimlerChrysler: Wie die Homepage ausweist, gehörte der Konzern am 31. Juli zu 6,9 Prozent der Deutschen Bank und zu 7,2 Prozent dem Emirat Kuwait. Der Rest war Streubesitz: Privatinvestoren hielten 25 Prozent, institutionelle Investoren 60,9 Prozent. Der Firmenchef ist heute nicht mehr der Besitzer, sondern ein Manager. Was die Linken wie einen Klassenkampf zwischen Arbeitnehmern und Eigentümern inszenieren, ist tatsächlich ein Ringen zwischen abhängig Beschäftigten.
Dieser Kampf ist sinnlos. Auch sonst ist der Gegner verstörend uneindeutig: Der Reichtum ist zwar extrem ungerecht verteilt. Trotzdem gehören die großen Firmen nicht mehr nur anonymen Milliardären, die lässig beim Golf ihre umfangreichen Depots verwalten. Der weltweit größte Aktienfonds ist der Pensionsfonds der öffentlichen Bediensteten in Kalifornien. Darauf hat der Unternehmensberater Roland Berger zu Recht hingewiesen (taz vom 17. 12.). Wenn Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, Renditen von 25 Prozent anpeilt, dann profitieren auch viele Kleinanleger. Sie sind genauso anspruchsvoll wie Großkunden - auch der normale Angestellte sucht seine Lebensversicherung nach der Ertragstabelle aus.
Widersinnig sind auch die Boykottpläne, mit denen abwandernde Firmen abgestraft werden sollen: Diese "Kauft deutsch"-Kampagne hat etwas Nationalistisches. Vor allem aber wird ignoriert, dass Deutschland 2005 schon wieder absoluter Exportweltmeister ist. Wir führen weit mehr Güter aus, als wir einführen - und verlagern damit Arbeitslosigkeit in andere Länder. Da ist es volkswirtschaftlich nur fair, wenn dieser Effekt zumindest ein wenig korrigiert wird, indem deutsche Firmen gelegentlich Jobs ins Ausland umschichten.
Aber diese Globalsicht dringt nicht durch; viel stärker beeindrucken die Fernsehbilder, die verzweifelte AEG-Mitarbeiter in Nürnberg zeigen. Sie haben ein Recht auf Wut und Trauer, und sie haben ein Recht darauf, von der Gesellschaft mehr zu erhalten als nur Hartz IV. Doch die bittere Ironie ist: Solange die empörten Fernsehzuschauer nur gebannt auf Einzelfirmen starren und Manager anklagen, wird es nie gelingen, den gesellschaftlichen Reichtum gerechter zu verteilen.
Es ist keine harmlose Nostalgie, sich "die Wiederkehr des alten Patriarchen zu ersehnen" (Greiner). Denn der moralische Appell an die Unternehmer wirkt paradox. Er erscheint wie eine ultimative Drohung, doch gleichzeitig formuliert er eine Heilserwartung, die den Kapitalbesitzern grenzenlosen Einfluss zuschreibt. Die Empörten haben vergessen, dass für das Volkswohl nicht die Bosse zuständig sind - sondern die Parlamentarier. Selbst Linke glauben heute, dass Betriebs- und Volkswirtschaft identisch seien. Sie vertrauen derart inniglich auf die Firmenchefs, dass sie vergessen, dass man ruhig die Unternehmensteuern erhöhen könnte. Stattdessen trachten sie danach, die Manager moralisch zu läutern.
Dabei berufen sich die Empörten gerne auf Artikel 14 des Grundgesetzes, der im zweiten Absatz dekretiert, dass "Eigentum verpflichtet". Allerdings macht der erste Absatz klar, dass es ein Missverständnis wäre, zu glauben, dass damit vorrangig der moralische Appell an einzelne Unternehmer gemeint wäre, der von engagierten Bürgern ausgesprochen wird. Oder von der Bild-Zeitung. Stattdessen formuliert der erste Absatz, welche "Schranken" es für das Eigentum gibt - die durch "Gesetze bestimmt" werden. Mit diesem Absatz werden übrigens so unterschiedliche Eigentumsbeschränkungen wie der Umweltschutz, der Arbeitsschutz oder auch die progressive Einkommensteuer begründet. Artikel 14 ermächtigt also den Staat, das Parlament, nicht selbst ernannte Moralisten. Warum können selbst Linke damit nichts mehr anfangen, obwohl dies urlinkes Gedankengut ist?
Vielleicht lässt sich diese merkwürdige öffentliche Empörung damit erklären, dass die Fronten so unübersichtlich sind. Die Bürger kommen mit ihren vielfältigen Rollen nicht mehr zurecht. Als Kunde profitieren sie vom gnadenlosen Wettbewerb; als Anleger freuen sie sich über Kurssprünge und hohe Dividenden. Doch als Angestellte sind sie Opfer dieser Trends - ihre Löhne stagnieren, ihre Jobs könnten eingespart werden.
Diese Zerrissenheit wird noch zunehmen. Auch durch politische Maßnahmen, die von fast allen gewünscht sind. So würden 85 Prozent aller Bundesbürger ihre Rente am liebsten weitgehend privat ansparen. Wieder sagt der Instinkt: Bloß keine Lösungen vom Staat erwarten, etwa eine steuerfinanzierte Altersvorsorge. Doch die Privatisierung würde die Pensionsfonds weiter aufblähen, die schon jetzt den rabiaten Renditekurs der Aktiengesellschaften bestimmen - siehe DaimlerChrysler.
Dieser unreflektierte Instinkt lässt sich politisch bestens ausnutzen. In den Vereinigten Staaten will Präsident Bush die Renten ebenfalls privatisieren. Sein Chefberater Grover Norquist fühlt sich so sicher, dass er die Motive sogar öffentlich erläutert: "Wenn wir mehr Leute zu Investoren machen, dann schaffen wir mehr Republikaner und weniger Demokraten." Denn Kleinanleger reagieren wie Großaktionäre: Sie werden konservativ. Wer also nicht als staatsferner Neoliberaler enden will, sollte etwas selbstkritischer sein. Es ist absurd, gegen den mangelnden Anstand von Unternehmern zu wettern - wenn es doch wahrscheinlich ist, dass der Kritiker indirekt selbst dieser Unternehmer ist.
ULRIKE HERRMANN
taz Nr. 7850 vom 20.12.2005, Seite 12, 241 Zeilen (Kommentar), ULRIKE HERRMANN
... link (14 Kommentare) ... comment
(vgl. Hartmann, Detlef, Völkermord gegen soziale Revolution. Das Wirtschaftssystem von Bretton Woods als Vollstrecker der nationalsozialistische Neue n Ordnung, in: Klassengeschichte=soziale Revolution?, Autonomie Neue Folge Nr.14)
Konkret ging es hierbei um Folgendes:
Die Geldpolitik der USA und wenn man das so sagen kann "des Westens" in den keynesianisch geprägten Nachkriegsjahrzehnten war expansiv ausgelegt und trachtete in Tradition des Marshallplans vor alle danach, industrielle Entwicklung und Wachstum zu fördern. Die sich emanzipierenden jungen Nationalstaaten der "Dritten Welt" wurden mit Entwicklungskrediten unterstützt. Dieses Modell war nur vor der Systemkonkurrenz mit dem kommunistischen Lager denkbar, es ging dabei um die gegenseitige Umwerbung von Entwicklungsregimen (am Klügsten machte das Maltas Dom Mintoff, der abwechselnd proamerikanisch, prosowjetisch, prochinesisch und prolibysch war, je nachdem, von wem er gerade eine neue Werft oder Raffinerie brauchte). Dieses Modell geriet anfang der 70er in die Krise, diese war vor allem eine Krise des US-Imperialismus.
Einerseits hatten sich mittlerweile alle westlichen Nationen mit der Verschuldung zur Entwicklung ihrer eigenen Wirtschaft und mit der Gewährleistung sozialer Leistungen überhoben. Im Vordergrund stand damals aber vor allem die Tatsache, dass die USA in Vietnam und phasenweise auch in Kampuchea und Laos einen Krieg führten, den sie nicht gewinnen konnten und der nicht länger bezahlbar war. Bis dahin war die gesamte fluktuierende Menge an US-Dollar durch einen Goldschatz in Fort Knox gedeckt; nun begann man, zur Finanzierung der Kriegskosten die Notenpresse anzuwerfen und ungedecktes Geld zu drucken, parallel den National Treasure Stück für Stück zu verscherbeln, um an Auslandsdevisen zu kommen. Je mehr sich die Niederlage in Vietnam abzeichnete, desto mehr trudelte der Kurs des Dollars ins Bodenlose. Dies führte nicht nur zur Inflation in den USA, sondern auch zu einer Weltwährungskrise, denn im Bretton-Woods-System waren alle frei konvertiblen Währungen fest miteinander verrechnet, der Dollar stellte aber die Leitwährung dar. Wäre man nach dem Prinzip einer keynesianisch regulierten Marktwirtschaft mit gleichen und freien Partnern verfahren, so hätte man die Leitwährung Dollar sinnvoller Weise durch eine härtere Währung ablösen müssen. Gelöst wurde das Problem stattdessen auf eine sowohl marktradikale als auch imperialistische Weise.
Zauberworte waren Monetarismus und Deregulierung. Nicht steigender Lebensstandard in den Industrieländern und eine hohe Binnenachfrage, wie sie bisher erwünscht waren, sondern Freigabe der Währungen, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden können, sowie möglichst starke und stabile Währungen sollten nun im Mittelpunkt stehen, diese waren aber nur gewährleistet, wenn Staatsausgaben gesenkt wurden. In Zeiten des Kalten Krieges mit garantiert hohen Rüstungsausgaben waren dies zwangsläufig soziale Leistungen und Bildungsausgaben. Hier sehen wir, wie Probleme teilweise erst durch ihre vorgeblichen Lösungen entstehen. Die USA hatten ein Problem mit ihrer Währung aufgrund eines nicht mehr gewinnbaren oder finanzierbaren Krieges. Da die USA nicht irgendein Staat sind, sondern die imperiale Führungsmacht des Westens, wurde dieses Problem auf die ganze westliche Welt einschließlich der von westlichen Krediten abhängigen Entwicklungsländer abgewälzt. NIcht nur den westlichen Industrienationen - ursprünglich nur den USA - empfahlen die Hayekianer um Friedman das Konzept des Gesundsparens und Sozialabbaus (der sich mit ihren ideologischen Vorstellungen eins puren Manchesterkapitalismus deckte, der übrigens nicht mit politisch liberalen Vorstellungen verknüpft war), sondern auch Weltbank und Internationalem Währungsfond. Mitte der 70er befand sich der US-Imperialismus eindeutig in der Defensive: Vietnam-Krieg endgültig verloren, Nixons Gegenrevolution gescheitert, Black Power immer noch die Systemopposition im eigenen Land, die Unruhen in Nordirland ließen eine soziale Revolution an der Peripherie Nordwesteuropas möglich erscheinen, und mit dem Jom-Kippur-Krieg schuf Ägypten nicht nur für sich mit Israel eine Verhandlungsposition auf Augenhöhe, sondern gab der OPEC den Startschuss für eine weltweite beträchtliche Ölpreiseerhöhung. Entwicklungspolitik und soziale Leistungen auf Pump schienen ebenso am Ende, wie die Vorherrschaft des US-geführten Westens an der Bruchkante erschien, ohne dass ein neues Weltsystem sichtbar war. In dieser Situation begannen verschiedene Regierungen, u.a. Reagan in den USA, Thatcher in Großbritannien, die Pinochet-Diktatur in Chile und die Junta der Generäle in der Türkei in unterschiedlicher Weise die Friedman-Konzepte zu adaptieren und umzusetzen. Als Vorgabe für IWF und Weltbank bedeutete dies ein Knapperwerden von Entwicklungskrediten, die strukturelle Unlösbarkeit der Schuldenkrise der armen Länder und die IWF-Auflage an diese Länder, die staatliche Subventionierung des Brotpreises aufzuheben, was faktisch oftmals darauf hinauslief, Bevölkerungteile dem Hungertod zu überanworten. So bezeichnete man die Brotpreisrevolten in Mexiko, Ägypten, Marokko, Algerien und Tunesien in den 80er Jahre, die meist blutig niedergeschlagen wurden, als IWF-Riots. Tatsächlich sagte einer der höchsten Vertreter der Weltbank mir gegenüber im persönlichen Gespräch: "Wir wollen diese Länder destabilisieren. Sie haben keine marktwirtschaftliche Ordnung, deshalb sind uns Aufstände dort willkommen, um die staatlich gelenkten Wirtschaftssysteme zu schwächen."
Die betriebene Entwicklungspolitik ist also eine durch und durch ideologische Veranstaltung, der es um die Durchsetzung der Hayek/Friedmanschen Ideen des gewünschten Wirtschaftssystems geht, auch wenn es dabei ziemlich viele Tote gibt.
Eine, wenn auch über diverse Eskalationphasen hochgeschaukelte Folge der Auflagen des größten jemals vergebenen IWF/Weltbankkredites war der jugoslawische Bürgerkrieg.
... link (4 Kommentare) ... comment
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahamas_%28Zeitschrift%29
Dieser wurde seinerzeit mit einer großen deutschen Gründlichkeit und Verbissenheit ausgetragen.
Ich habe meine Meinung dazu ja nun schon deutlich gemacht:
http://che2001.blogger.de/stories/386740/,
und ich bin nicht der Auffasssung, dass sich die für sich genommen entsetzliche Tatsache, dass bei der Flugzeugentführung von Entebbe wie an der Rampe eines KZs jüdische und nichtjüdisch Passagiere selektiert wurden oder dass bei Personen aus der RAF-Gründergeneration ein antifaschistischzer Philosemitismus schnell in eine bedingungslose Zustimmung zum eleminatorischen Antizionismus der damaligen PFLP umschlug es zulassen, linken Antiimperialismus mit Antisemitismus im Allgemeinen in Verbindung zu bringen. Als Vertreter des an sozialen Bewegungen, nicht an Staaten festgemachten Neuen Antiimperialismus und der Verbindung aus Kritischer Theorie und französischem Strukturalismus waren mir all die Debatten, die Staaten, Nationen usw. zum Gegenstand hatten eher schnurz, andererseits konnte ich auch mit der Pervertierung der Kritischen Theorie seitens einiger Hamburger Antideutscher nichts anfangen, die darauf hinauslief, den Deutschen kollektiv einen Nationalcharakter zuzusprechen, der schlechter sei als der aller anderen völker, und daraus Prozionismus als einzige mögliche Praxis der deutschen Linken abzuleiten.
Unsereins stand dem Ostblock ebensofern wie dem westlichen Kapitalismus, daher nahmen wir den Zusammebruch 1989/(90 nicht einmal als Schwächung der Linken wahr. "Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist nur übriggeblieben", diese Position vertrete ich heute noch und sehe die verschärften "Globalisierungsphänomene" eher als das konvulsivische Zucken eines sich einer historischen Krise nähernden Kapitalismus denn als Zeichen seines Sieges.
Aber speziell die dem Kommunistischen Bund (KB, von härteren Autonomen Kotzbrech genannt, nein, liebe Ex-KB-GenossInnen, von mir nicht) nahestehenden Leute hatten hierzu ein anders Verhältnis, der Zusammenruch des Warschauer Vertrages lief für sie vor allem auf eine Stärkung des Deutschtums mit der Gefahr eines Wiedererstarkens des Faschismus hinaus, eine in Mikrophäönomenen (Neonazis, Remilitarisierung der Außenpolitik) zwar richtige, in historischer Perspektive aber doch reichlich hysterische Annahme.
Liebknechts Position "Der Hauptfeind steht im eigenen Land" wurde so dogmatisch interpretiert, dass Kritik an der US-Außenpolitik nicht mehr möglich erschien.
Und mittlerweile sind die Bahamas im Sumpf der Neocons gelandet. Man kann eben auch so links sein, dass man schon wieder rechts ist.
... link (12 Kommentare) ... comment
Mit Tempo kam der New Journalism nach Deutscland, Tempo war innovativ, soso. Abgesehen davon, dass es sich letztlich um ein deutsches Remake des Wiener handelte, hatten schon vorher Stadtzeitungen den Trend gesetzt, der nun lediglich überregional nachvollzogen wurde: Ab 1983 der Berliner Tip, ab 1984 das Hiero Itzo in Göttingen, ab 1985 ebenfalls in Göttingen der Charakter. Für uns waren alle diese Trendsettermagazine Feindpresse: Propagandaorgane des Yuppie-Lebensstils, der von uns Linken als eklig angesehen wurde und soziokulturell gesehen als bekämpfenswert galt, verschärft noch einmal durch solche Leute:
http://www.insight-online.de/Fragebogen/index.php?id=19,
also Träger dieser Art von "new journalism", die, heute Anti-Imp-Zirkel, morgen Kirch-Gruppe, als Verräter unserer Ideale galten.
Gelesen haben wir das Tempo trotzden, heimlich, auf dem Klo, oder am WG-Küchentisch, um uns über die Inhaltsleere aufzuregen. Auch wenn wir es nicht eingestanden, irgendwo hatten die bunten Bilder ihren Reiz. Ein Linker als bekennender Tempo-Leser wäre aber so undenkbar gewesen wie Alice-Schwarzer als Playboy-Leserin. Heute sieht man das alles in einem milderen Licht, man hat ja selbst Karriere gemacht und sich irgendwie arrangiert, gegenüber früheren Mitstreitern, die die eigenen Genossen ganz unmittelbar behumst und abgezockt haben, erscheinen auch die alerten Karrieristen als weniger schlimm. Heutzutage, wo es von Blättern wie Max, Prinz, Esquire, GQ, Men´s Health etc. wimmelt, sehnt man sich fast zurück nach der Zeit, als ein paar Stadtmagazine, Tempo und Wiener eine inselartige Sonderstellung hatten. Wunder nimmt mich bei der Wikipedia-Darstellung allerdings die Tatsache, dass Coupé als eines der Blätter bezeichnet wird, die dem Tempo das Wasser abgruben. Coupé? Das ist eine Billigillustrierte mit Soft-Porno-Komponente, ein Blatt, das ich zwischen Super-Illu, St.Pauli-Nachrichten und Gala ansiedeln würde, oder in der Nähe der Praline. Was das nun allerdings mit new journalism und dem ja bewusst elitären Trendsetting von Tempo und Wiener zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht. Selbst wenn die Computer-Bild der Page Anzeigenkunden abgräbt, ähneln sich dadurch noch nicht die Blätter .
... link (2 Kommentare) ... comment
... link (3 Kommentare) ... comment
Sehr schön, was Anderes als diese unerträgliche Schwarz-Weiß-Einteilung der Welt, beruhigend.
... link (4 Kommentare) ... comment
Berlin, 23.02.2006 – Um die Rechtsstaatlichkeit von politischen Verfahren in der Türkei steht es auch nach den Reformen der letzten Jahre schlecht. Unter Folter erpresste Geständnisse werden weiterhin vor türkischen Gerichten als Beweis zugelassen und tragen entscheidend zur Urteilsfindung bei. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die amnesty international, die Stiftung Pro Asyl und die Holtfort-Stiftung in Auftrag gegeben haben.
Damit widersprechen die Organisationen der bei deutschen Behörden und Gerichten vorherrschenden Meinung. Das Auswärtige Amt und deutsche Verwaltungsgerichte bescheinigen der Türkei umfassende rechtsstaatliche Reformen. Dies führt dazu, dass gefährdete Flüchtlinge aus der Türkei in Deutschland keinen Schutz erhalten: Einige verlieren ihre Anerkennung als Asylberechtigte, andere werden in Strafverfahren an die Türkei ausgeliefert, wo ihnen ein unfaires Strafverfahren droht.
In den untersuchten Fällen haben weder die Staatsanwaltschaft noch die Richter den Vorwurf der Folter angezeigt, obwohl sie dazu als Staatsbeamte verpflichtet gewesen wären. Gerichte nehmen in der Regel Foltervorwürfe nicht ernst, sondern werten sie als den Versuch der Angeklagten, ihrer Bestrafung zu entgehen. Die Studie untersucht insgesamt 18 Fälle. Darunter ist auch der Fall des aus Deutschland abgeschobenen Metin Kaplan. Auch bei ihm wurden erfolterte Beweise im Verfahren verwendet, das mit einem Schuldspruch endete.
Nach türkischem Recht dürfen Aussagen, die unerlaubt herbeigeführt wurden, vor Gericht nicht verwendet werden. Die Türkei ist zudem Vertragsstaat der UN-Antifolterkonvention, die die Verwen=ung erfolterter Aussagen gleichfalls verbietet.
Der Gutachter Helmut Oberdiek hatte Zugang zu Gerichtsakten, führte ausführliche Gespräch mit Rechtsanwälten Betroffener und beobachtete einige Prozesse vor Ort.
... link (0 Kommentare) ... comment
Das sowohl flächenmäßig als auch von der Einwohnerzahl her größte islamische Land ist die Republik Indonesien. Dort gibt es zwar auch Terroristen, die mit der Jamma Islamiya ihre eigene Organisation haben, aber die überwiegende Mehrheit der indonesischen Muslime steht fundamentalistischem Gedankengut fern und lebt auch einen wenig strengen Islam, z.B. tragen Frauen das Kopftuch fast nur zum Gottesdienst. Den indonesischen Muslimen sind Israel und der ganze Nahostkonflikt dermaßen was von schnurzegal, und wenn es religiöse Spannungen gibt, dann mit Hindus, nicht mit indonesischen Juden. So, und wenn wir die Muslime in Indonesien, Malaysia, Bangla Desh, China (Sinkiang-Uighur ist mehrheitlich muslimisch) und Sibirien zusammenrechnen, dann kommt da locker die Häfte der muslimischen Weltbevölkerung raus, und das sind fast alles Leute, die sich für Israel und den Nahostkonflikt nicht interessieren. Der engste militärische Verbündete Israels aber ist die Türkei, in der eine islamistische Partei an der Regierung ist. Also: Die Muslime, die Israel vernichten wollen, sind aus bestimmten politischen Motiven heraus aufgehetzte Leute vor allem in arabischen Ländern und dem Iran (wo mir noch zweifelhaft erscheint, dass Ahmadinejads Vernichtungsdrohungen eine Massenbasis haben, der Durchschnittsperser ist von dem ganzen Regime ziemlich abgenervt), aber nicht "Die Muslime" oder "Der Islam".
Der ***** hörte sich das an und meinte dann, na gut, dann müsse man die Araber und Iraner sagen. Ich meinte, nein, auch die nicht in ihrer Gesamtheit, sondern nur ganz bestimmte Leute. Ja, ob ich denn den Terror im Irak rechtfertigen wolle "Natürlich nicht", erwiderte ich "der richtet sich doert ja gegen die eigene Bevölkerung. Eine Massenbasis unter den normalen Irakern hat dieser Terror nicht." "Einmal möchte ich eine Demonstration gegen die Gewalt im Irak sehen," versetzte der *****. "Die gibt es regelmäßig, nur kriegen wir davon nichts mit", erwiderte ich. "Ich habe im Fernsehen noch keine gesehen." "Es wird ja auch nur das gezeigt, was spektakulär ist, auch Nachrichtenbilder sind inszenierte Bilder." "Jaja, du beschönigst alles und erklärst diese Leute da auch noch zu unbefleckten Unschuldsengeln, du bist ja sowieso immer nur auf deren Seite, mit dir kann man darüber überhaupt nicht reden, also rede ich mit dir nicht mehr darüber."
Dann mischte sich auch noch die **** in das Gespräch ein und erklärte, ihre Freundin ****** sei krank und deshalb zum Arzt gegangen, aber das ganze Wartezimmer sei voll von Türken gewesen, da hatte sie es sich nicht angetan, sich dazwischen zu setzen, die stinken ja auch alle so, und sei wieder gegangen.
Ja Klasse. Ich kann mich an ein Schulbuch aus dem Dritten Reich erinnern, wo geschildert wird, wie schrecklich es sei, im Schwimmbad plötzlich von lauter Juden umgeben zu sein.
So weit sind wir schon wieder: Während kurdische Freunde ihre eigene Lage mit der verfolgter Juden vergleichen, und es sind genug Parallelen da, produziert der deutsche Volksmund bereits wieder die klassischen Stereotypen des Antisemitismus, nur mit neuen Objekten der Abneigung. Bravo, Deutschland!
... link (2 Kommentare) ... comment
Beamter: "Was sind Sie denn für ein Landsmann?"
Hajdar: "Kurde."
Beamter: "Und aus welchem Land?"
Hajdar: "Aus Kurdistan."
Beamter: "Ah ja, Kurdistan."
Dann fragte der Beamte, wieso es nur Elektroherde gäbe und keine Gasherde, und die Antwort, die Hajdar da gab, ließ einem ja fast das Blut in den Adern gefrieren. Er sagte: "Wir Kurden haben was gegen Gas, das ist so ähnlich wie mit den Juden."
Der Mann war vor deutschem Giftgas aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet, wissend, wo das Gas herkam - und wie alle mir bekannten Kurden mit dieser Biografie hat er eine sehr spezielle Art, die Dinge auszusprechen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Die Schuberth GmbH gilt neben Nolan in Italien als einer der beiden weltbesten Hersteller für Motorrad- und Formel 1-Helme. Doch in den letzten Jahren verschlechterte sich die Profitrate, unter Schubert-CEO Zahn erklärte, es gäbe keine Alternative zu einer Verlagerung der Produktion nach Magdeburg. Dort wurde ein neuartiges Werk aus dem Boden gestampft mit den neuartigsten Produktionsanlagen, und Cleverchen Zahn ließ sich den Umzug vom Land Sachsen-Anhalt subventionieren. Das Personal in der Produktion bekommt in Magdeburg 80% weniger als in Braunschweig, was auch der Sinn des Umzugs war. Schuberth war gerettet, so hieß es.
Wohl nicht so ganz: Obwohl Kaufinteresse auch eines Braunschweiger Investors vorliegt, werden die Schuberth-Werke in die USA verkauft, Zahn bleibt jedoch Geschäftsführer. Angeblich sei keiner der Arbeitsplätze in Braunschweig oder Magdeburg gefährdet.
Na, das wollen wir doch mal abwarten. Ich habe schon Pferde kotzen sein, und das direkt an der Kirchhofsmauer.
Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2043/artid/5039482
... link (0 Kommentare) ... comment
Kaum angekommen, werden sie gleich auf ein Dorffest eingeladen,
und da wird die Tochter von einem stattlichen jungen Bayern
in landesueblicher Tracht zum Tanz aufgefordert.
Als sie nach drei Taenzen wieder zu ihrem Vater zurueckkehrt, sagt der:
"Siehste, jetz haste ooch ma mit'n richtijen Bayern jetanzt!"
"Nee, Papa," antwortet sie, "det war'n Italiener". "Quatsch!" sagt
der Vater, "kicken Dir doch an: Die Seppelhosen, und der Hut
mit'n Jamsbart - det is'n Bayer, det sieht doch'n Blinda
mit'n Kruckstock!"
"Nee, Pappa, det ist'n Italiener, der hat doch mit mir Italienisch
gesprochen!" "Wieso, wat hatta denn jesacht?"
"Ich weiss nicht, es klang wie ...'difickiano'..."
... link (0 Kommentare) ... comment
... link (2 Kommentare) ... comment

